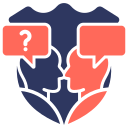Wörter, die anders wirken
In Low-Context-Umgebungen gilt direkte Sprache als effizient. Wo Höflichkeitsstrategien dominieren, schützt indirekte Formulierung die Beziehung und das Gesicht. Ein klares Nein kann dort über Umwege erscheinen. Mit Empathie, Rückfragen und paraphrasierender Bestätigung gelingt es, beides respektvoll zusammenzubringen.
Wörter, die anders wirken
Worte tragen Geschichte. „Gift“ bedeutet auf Englisch Geschenk, auf Deutsch Gefahr. Solche Fallen lauern auch in Metaphern und Sprichwörtern. Prüfen Sie, ob Bilder kulturell teilen lassen, oder exklusiv sind. Nutzen Sie alltagsnahe Beispiele und lassen Sie sich Feedback geben, bevor Missverständnisse zementiert werden.
Wörter, die anders wirken
Eine kurze, stichpunktartige E-Mail wirkte auf Kolleginnen als schroff, obwohl sie in einer Low-Context-Praxis als normal gilt. Ein freundlicher Einstieg, eine kleine Dankeszeile und klare nächste Schritte harmonisierten Erwartungen. Probieren Sie es aus und berichten Sie uns, welche Formulierungen bei Ihnen Brücken bauten.